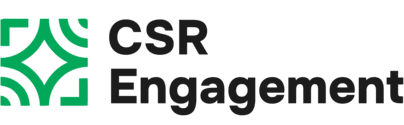Die Situation zur Seenotrettung in der EU spitzt sich weiter zu, an klaren Beschlüssen auf EU-Ebene fehlt es aber weiterhin. Beim Treffen der Innenminister am 8. Oktober in Luxemburg fiel das Fazit Horst Seehofers, nach großen Erwartungen, ernüchternd aus: „Solche Prozesse entwickeln sich prozesshaft“. Die Diskussionen drehen sich weiterhin um die Aufnahmekapazitäten und -Willen der EU-Staaten und es zählt, dass sich weitere EU-Staaten, neben Italien, Malta, Frankreich und Deutschland, dem freiwilligen EU-Notfallmechanismus anschließen und damit die unwürdige Situation der Menschen, die wochenlang auf dem Mittelmeer treiben ohne irgendwo anlegen zu können, zu beenden.
„Der Weg kann zurzeit nur über Freiwilligkeit gehen oder über Anreizsysteme“, sagt Petra Bendel, Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Migration und Integration. Denn es gibt keine Mehrheit unter den Staats- und Regierungschefs aller EU-Länder, das europäische Asylsystem zu reformieren. Die Gegner einer Umverteilung, allen voran die osteuropäischen Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn, werden sich dem ohnehin nicht anschließen, erklärt sie ihren Standpunkt weiter.
Gegenspieler sind die Politiker bei diesem Thema nicht nur untereinander, Hilfsorganisationen wie die in 2015 gegründete Seenotrettung Sea-Watch, treten als weitere Partei auf dem Spielfeld auf. Als Initiative von Freiwilligen, setzt sie sich für die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeerraum ein. Mit ihrem Engagement stehen sie tagtäglich mit den politischen Aktivitäten im Konflikt. Denn während auf europäischer Ebene diskutiert und verhandelt wird, welches Land die Flüchtlinge aufnehmen kann und will, wird Sea-Watch eigenständig aktiv, um den auf dem Meer treibenden Menschen das Leben zu retten. Durch die zivilen Rettungsaktionen kommen die Seenotretter regelmäßig mit der Gesetzgebung in den Konflikt und werden z.B. der illegalen Einwanderung und Verletzung des Seerechts beschuldigt.
Seit 2015 war Sea-Watch an der Rettung von über 35.000 Menschen beteiligt. Über 500 Menschen auf der ganzen Welt verstärken die Sea-Watch-Crew mit ihrem Knowhow als Nautiker*innen, Mediziner*innen und Meachniker*innen. Die Rettungsaktionen selbst können dabei nur durch Spenden realisiert werden.
Zu der Crew gehört auch die Studentin Mattea Weihe. „Menschen kämpfen auf dem offenen Meer um ihr Leben, sie können nicht schwimmen, versuchen sich verzweifelt über Wasser zu halten, schreien, schlagen um sich“, so beschreibt die 28-Jährige ihre Erfahrungen als Seenotretterin. An Bord hat sie die Aufgabe, den ersten Kontakt zu in Seenot geratenen Menschen aufzubauen. Sie muss herausfinden, welche Sprache sie sprechen und sensibel auf die Extremsituation eingehen, in der sich die Geflüchteten oft schon seit vielen Tagen befinden. Manche von ihnen sind krank oder haben auf der Flucht Familienmitglieder oder Freunde verloren. Eine Arbeit, die sie manchmal an ihre Grenzen bringt.
Zurück aufs Spielfeld: neben der Behinderung ihrer Rettungsaktionen kritisiert Sea-Watch die EU, bestehende Milizen der sogenannten libyschen Küstenwache zu unterstützen. Diese zwingen die Flüchtlinge, fernab von Beachtung der Menschenrechte, in ein Bürgerkriegsland zurück. Stattdessen fordern sie eine #SafePassage, legale und sichere Fluchtwege in und nach Europa.
Alle Diskussionen werden letztendlich auf Kosten von Menschenleben geführt und es wird Zeit, dass die Gegenspieler zu Mitspielern, einem Team werden. Denn Stand jetzt, kann keine Partei alle Menschen retten.