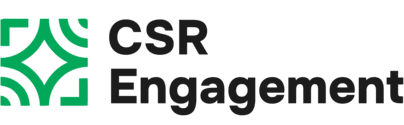Seitdem die Corona-Maßnahmen zur Ländersache geworden sind, gibt es auch in der Schulpolitik große Unterschiede. Ab dem 8. Juni heißt es in Schleswig-Holstein für alle Grundschüler im Bundesland: täglicher Unterricht in voller Klassenstärke, ohne Mindestabstand. Und ohne Schichtbetrieb, wie er derzeit in vielen Bundesländern erprobt wird. Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, rechtfertigt die Entscheidung damit, dass „die Kleinsten die größten Schwierigkeiten mit dem eigenverantwortlichen Lernen“ hätten. Aber auch mit dem „niedrigen Infektionsgeschehen“ in ihrem Bundesland. Bleibt dies unverändert, dürfen in der letzten Woche vor den Sommerferien dann die Schüler aller Jahrgänge tageweise in ihrem Klassenverband zusammenkommen. Auch der sächsische Kultusminister Christian Piwarz (CDU) begründet die Lockerungen in seinem Land mit dem „verbrieften Recht der Kinder auf Teilhabe und Bildung“.
Die Landesregierung von Schleswig-Holstein nutzt diesen Zeitraum auch klar als Testlauf, um nach den Sommerferien in einen geregelten Schulunterricht übergehen zu können. Aber ist es überhaupt sinnvoll wieder zur Normalität überzugehen, nachdem uns Corona die Defizite des deutschen Schulsystems aufgezeigt hat? Ein Unterricht an die Corona-Maßnahmen angepasst und damit der Abstandsregel gerecht werden, ist aus vielerlei Hinsicht gar nicht möglich. Die Klassenstärke hat über die letzten Jahre stark zugenommen – selbst Grundschulklassen knacken die Marke von 28 Schülern. Um diese Masse an Schülern in halber Klassenstärke angemessen unterrichten zu können, würde es einen erheblichen Anstieg der Lehrkräfte bedürfen. Auch die Klassenzimmer sind nicht mit der Klassenstärke gewachsen. Um ein Infektionsgeschehen vorzubeugen, müssten die Räume der Schulklassen größer und luftiger sein.
Es gibt folglich nur zwei Möglichkeiten, ohne den Gesundheitsschutz hintenanzustellen: Entweder man erklärt Lehrpläne, Präsenzunterricht und Prüfungen auch im nächsten Schuljahr für nachrangig. Oder man fängt an, gewaltig in die Schulen zu investieren und für eine Normalität unter Coronabedingungen aufzurüsten. Bei der ersten Möglichkeit kann die Gesellschaft nicht mitgehen und bei der zweiten scheitert es an den politischen Maßnahmen und Vorhaben.
Somit bleibt, ob Lockerungen der Abstandsregeln oder nicht, die große Gefahr bestehen, dass die Schulen ebensowenig für eine zweite Infektionswelle im Herbst gerüstet sind, als sie es schon nicht bei der ersten waren. Man würde schneller zum Stand jetzt der digitalen Unterrichtslösungen zurückkehren können, aber nachhaltig sind diese größtenteils auch nicht. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). „Trotz der Bereitstellung von Lehrmaterialen durch die Schulen wenden viele Schüler der Sekundarstufe II nur wenig Zeit für die Schule auf“, stellten die Forscher fest. Unter der Woche verbrachten 27 Prozent der Jugendlichen täglich vier oder mehr Stunden mit schulischen Aktivitäten. 35 Prozent wendeten zwei bis vier Stunden auf, 37 Prozent weniger als zwei Stunden. Gleichzeitig macht sich fast die Hälfte der Schüler große Sorgen, dass sich die Schulschließungen negativ auf ihre Leistungen auswirken. Dabei sehen bei einer Umfrage von 1700 Lehrer, 90 Prozent ein große Chance für die digitale Bildung. Einen Vorteil in dieser Situation haben nur wenige Schulen wie z.B. das Gymnasium im bayrischen Neustadt bei Coburg. Hier wurde über die letzten Jahre eine interne Schulcloud aufgebaut, über die bereits vor der Pandemie schon zwischen Lehrern und Schülern interagiert werden konnte. Um für den digitalen Unterricht jetzt auch noch die Videokonferenzen voranzutreiben, hat die Schulleitung einen externen Dienstleister beauftragt. Mit einem zentralen Server in der Schule gibt es keine Probleme mit dem Datenschutz und alle Schüler können darüber auf die Videokonferenzen zugreifen.
Mit diesem Postivbeispiel lässt ich aber leider auch der Teufelskreis erkennen, in dem sich das deutsche Schulsystem befindet. Nicht nur, dass die Bundesländer unterschiedliche Systeme und Lehrpläne haben, schon innerhalb der Länder gibt es zwischen den Schulen große Unterschiede, die größtenteils mit finanziellen Möglichkeiten zu begründen sind. Auch wenn die aktuelle Investitionslage in das Schulsystem, aufgrund der Corona-Hilfspakete in Milliardenhöhe, schwierig sind, hoffe ich, dass aus diesen offensichtlichen Erkenntnissen, die richtigen Maßnahmen für die Zukunft getroffen werden.