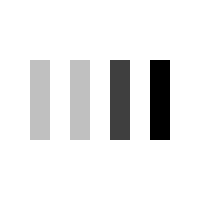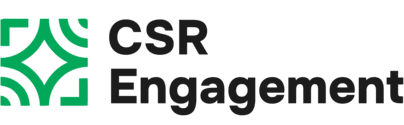In keinem anderen Land weltweit gibt es so viele vermisste Menschen wie in Nigeria. Im elften Jahr des bewaffneten Konflikts zwischen nigerianischer Armee und der Terrorgruppe Boko Haram (in der Haussa-Sprache: „die westliche Erziehung ist eine Sünde“) sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) fast 22.000 Menschen verschwunden, vor allem Minderjährige. Eine große humanitäre Krise, die auch auf die Nachbarländet Tschad, Niger und Kamerun übergegriffen hat. In Kämpfen und Massakern an der Zivilbevölkerung fanden bis heute mehr als 36.000 Menschen den Tod, zwei Millionen Drangsalierte machten sich auf die Flucht.
Drei Jahre lang recherchierte Edna O’Brian (90) an ihrem Roman Das Mädchen, den sie „den Müttern und Töchtern des nordöstlichen Nigerias“ gewidmet hat. Zwei mehrwöchige Reisen führten die Autorin in den Jahren 2016 und 2017 in das geschundene Land. Sie sprach mit Franziskanerinnen, besuchte Lager von Binnenvertriebenen und hörte die niederschmetternden Geschichten der einst entführten Mädchen. Und sie traf Dr. Oby Ezekweseli, der 2014 das Motto für den internationalen Aufschrei gegen die Entführung der nigerianischen Schülerinnen, dem auch Michèle Obama ihre Stimme verlieh, geprägt hatte: #BringBackOurGirls. Am Ende ihrer Erkenntnisse vor Ort stand für O’Brian fest, „dass die einzig mögliche Erzählstrategie für dieses Buch darin bestand, die Geschichten all der vielen gleichsam durch das Medium eines einzelnen erdachten Mädchens zu erzählen.“
Die Ich-Erzählerin der auf authentischen Berichten basierenden Handlung ist Maryam, die in den ersten Sätzen verdichtet, was auf 248 Seiten an verstörenden Geschichten, Erlebnissen und Demütigungen ausgerollt wird. „Ich war einmal ein Mädchen, aber ich bin es nicht mehr. Ich rieche. Bin voller getrocknetem, verkrusteten Blut, und mein Kleid ist zerfetzt. Mein Inneres ein Morast.“ Es folgt ein minutiös beschriebenes Narrativ des Terrors, der täglichen Erniedrigungen, der Massenvergewaltigungen und der brutalen Exempel, die an jenen Mädchen statuiert werden, die widerständig sind. Ihnen wird die Zunge herausgeschnitten. Andere bewegen sich – schwer traumatisiert – schlafwandlerisch-abwesend durch den Alltag, vor sich hinmurmelnd. Frauen bleiben in der perversen Ideologie der Fundamentalisten aber auf jeder Ebene Objekte, Ware, Mittel zum Zweck. Zu den eindringlichsten Passagen des Buchs gehört die auf vier Seiten scheinbar zeitlupenhaft geschilderte Steinigung der Frau des obersten Emirs des Kalifats, die des Ehebruchs bezichtigt wird.
Auch Maryam bleibt Beute und Trophäe, wird zur Belohnung mit Mahmoud verheiratet, der sich im Gefecht ausgezeichnet hat. Sein gebrochenes Bein muss später amputiert werden. Als er davon erzählt, dass er sein eigenes Dorf überfallen und seinen Cousin erdolchen musste, wendet sich Maryam von ihm ab, jedoch bereits von ihm schwanger mit Tochter Babby. Mit Burki, einer anderen Leidensgenossin, gelingt ihr bei einem Gefecht zwischen Armee und Terrormiliz, bei dem Mahmoud ums Leben kommt, die abenteuerliche Flucht über Felsplateaus und durch Wälder, immer auf der Suche nach Wasser und Nahrung. Kurzfristig findet die Ich-Erzählerin mit ihrem Kind Unterschlupf bei Nomaden. Als jedoch durchsickert, dass sie die Frau eines Boko Haram Milizionärs war, fürchtet man um die Sicherheit des Dorfes, sieht sie gar als Lockvogel, Todesbote, Selbstmordattentäterin.
Das Stigma der „Busch-Ehefrau“, des „schlechten Bluts“ und der Hure der Terroristen wird Maryam auch nach einer Therapie fortan nicht mehr los. Selbst bei der temporären Rückkehr zu ihrer Familie wird sie wie eine Aussätzige behandelt, ihre Tante entreist ihr die Tochter, da sie in ein Findelhaus gehöre. „Das Jesuskind befiehlt Dir, dieses Kind aufzugeben.“ Später gar wird der entwurzelten Mutter vorgespielt, das Kind sei gestorben. Ein Gefühl der Verlassenheit macht sich um sie breit. „Inmitten…der ganzen Heuchelei kam eine Schwärze in meinem Innern auf.“ Es ist kein Happy End, was dann folgt, aber Tochter Babby lebt und ist in einem Franziskanerorden untergekommen, wo Maryam fürs Erste mit ihr ein Zuhause auf Zeit und Sicherheit findet. Sie trennt sich von ihrer Familie, wo Vater und Bruder mittlerweile verstorben sind und lässt sich von Mutter Pius Bilder zeigen, die Kinder ermuntert hatte, irgendetwas aus ihrem Leben zu malen. Ein Bild zeigt „in tristem Grau eine Traube von Kindergesichtern, die aus dem Fenster schauten, in starrem, stummem Schrei. Es trug den Titel Zuhause.“
Wenn es die Aufgabe von Literatur ist, jenen eine Stimme zu verleihen, die sonst nur als Sandkorn der Geschichte aufscheinen würden, so ist dies Edna O’Brian mit diesem mutigen Buch mehr als gelungen, da sie den Chibok Girls ein Denkmal dafür setzt, dass sie selbst in der Hölle von Gewalt und Erniedrigungen ihre Würde bewahren. Doch leider ist deren Geschichte noch nicht auserzählt. In einem Interview sagte die Autorin: „Manchmal schrecke ich nachts hoch und denke an die Mädchen und das Schreckliche, was ihnen widerfahren ist. Doch ich konnte wieder nach Hause fahren. Die jungen Frauen werden bis an ihr Lebensende mit den Erinnerungen leben müssen.“
Edna O’Brian, Das Mädchen, 1. Auflage 2020, Hoffmann und Campe, ISBN 978- 3 -455 -00826 – 5, 23,00 Euro