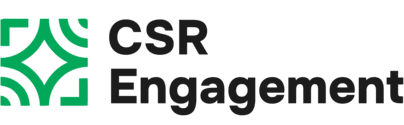Jeder achte Erwachsene hat Schätzungen zufolge als Kind sexuelle Gewalt erlebt. Der Redaktionsleiter von Christ & Welt bei der ZEIT, Raoul Löbbert sagt: „Viele schließen nicht ab, haben für ihre Gefühle keine Sprache, verlieren tatsächlich den Glauben an Gott und das Leben und nehmen für immer Schaden an Körper und Psyche.“ Und Matthias Katsch, Sprecher der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch e.V., der als Jugendlicher an einem Jesuiten-Kolleg sexuell misshandelt wurde, sagt: „Wir schleppen die Last des Schweigens, der Schuld und der Schamgefühle durch unseren Alltag.“
Einer, der den Großteil seines Lebens an dieser Last geschleppt hat, ist der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger, der „seinen Fall“ erst aufschreiben konnte, als die sakralen Päderasten Pater Gottfried Eder, Pater Maurus König und Stiftsorganist Victor Adolf verstorben waren. „Ich war nicht bereit, sie zu verraten. Nun bin ich es, weil sie tot sind.“ Alle hatten sich über vier Jahre am Zögling des Zwettler Sängerknabenkonviks, damals eines der ältesten Knabenchöre Österreichs, vergangen. Haslinger spürt beim Schreiben, wie sich der Stoff sperrt, wie die Verstörung andauert, wie wirkmächtig bis hin zur Täteridentifikation das Geschehene noch ist. Und er konstatiert, dass er nicht der einzige sei, „der erst im reifen Alter in die Lage kam, sich seiner Lebenslügen über den eigenen Missbrauch zu stellen.“
Der Klasnic-Kommission, einer von der Bischofskonferenz finanzierten Opferschutzanwaltschaft, präsentiert Haslinger seine Geschichte dreimal vor unterschiedlichen Gremien, bis man ihn auffordert, diese selbst aufzuschreiben. „Kommissionen haben eben etwas Kafkaeskes“, konstatiert er und merkt schnell, dass es mit der Unabhängigkeit der Institution nicht weit her ist. Belletristisch hatte sich Haslinger bereits zuvor mit Kurzprosa-Texten wie „Der Konviktskaktus“, „Die plötzlichen Geschenke des Himmels“ und „Im Spiegelsaal“ seiner verstörenden Geschichte genähert, aber sie bleibt ein „unentwirrbares Knäuel von Akten der Gewalt und Momenten der Scham.“ Und er ringt nach Entschuldigungen, damit vermeintlich verheilte Wunden nicht wieder aufbrechen: „Wenn man lange an selbstgestrickten Mythen festgehalten hat, scheut man den Ernüchterungsprozess.“
Wesentlich radikaler geht die Britin Rosie Price in ihrem Debutroman „Der rote Faden“ mit der eigenen Vergewaltigung um, die sie minutiös beschreibt. „Eine Lücke zu lassen oder die Sache zu umschreiben, vergrößert doch nur die Scham. Es wirkt dann so, als sei eine Vergewaltigung etwas Unaussprechliches. Und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis Opfer glauben, etwas an ihnen sei unaussprechlich. Dabei sollten die Täter sich schämen. Nicht die Opfer. Ich glaube, ich habe diese drastische Schilderung aus Wut geschrieben. Ich wollte sagen: schaut es euch an. Das ist passiert.“
Haslinger, drangsaliert zwischen zehn und 14 Jahren, ursprünglich beseelt von dem Wunsch Priester zu werden, konnte diesen Weg nicht gehen. Er redet sich die Übergriffe als Zuwendung schön, nennt die Peiniger „persönliche religiöse Berater“ und relativiert bis in den Buchtitel („Mein Fall“) hinein, das Verbrechen an Schutzbefohlenen. „Es war eine Missbrauchsaffäre. Aber eine Affäre, von der die Öffentlichkeit nichts erfährt, ist eigentlich keine Affäre, sondern ein bloßer Vorfall.“ Das ist das Verstörende am Buch Haslingers, dass es zeigt, wie junge und gedemütigte Seelen lebenslang an ihren Traumatisierungen leiden.
Josef Haslinger, Mein Fall. S. Fischer Verlag, 140 Seiten, ISBN 978-3-10-030058-4,
20,00 Euro