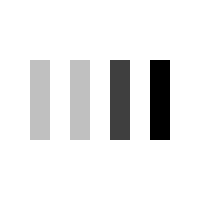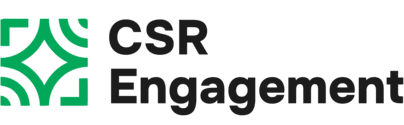Martin Haller war ein Kind des Hamburger Bildungsbürgertums. Hineingeboren in einen musischen Haushalt als zweiter Sohn christlich getaufter jüdischer Eltern. Sein Vater Nicolaus Ferdinand ein erfolgreicher, humorvoller Jurist, ist erst Präses der Finanzdeputation und wird 1863 als erster Senator jüdischen Ursprungs sogar Hamburgs Bürgermeister. Sohn Martin steigt über den Schulabschluss am humanistischen Johanneum in die geistige Elite der Stadt auf, beherrscht später neben Griechisch und Latein auch Englisch und Französisch. An der Gewerbeschule nimmt er Zeichenunterricht und beteiligt sich 1854 schon als 18-jähriger Gymnasiast anonym mit einem Kuppelbauentwurf am Rathauswettbewerb. Der Sitz von Senat und Bürgerschaft war 1842 dem Großen Brand zum Opfer gefallen. Es sollten noch zwei weitere Wettbewerbe ausgeschrieben werden, bis Haller sich in der Geschichte den Ruf als Rathausbaumeister erwerben sollte. „Meine hauptsächlichste Lebensaufgabe“ nennt Haller in seinen Lebenserinnerungen, die er in elf Kladden auf 1.100 Seiten zwischen 1913 und 1920 zu Papier bringt, später die Beschäftigung mit dem Bau des Hamburger Rathauses.
Haller – mittlerweile 50-jährig – ist schließlich Kopf des Rathausbaumeisterbundes aus renommierten Architekten, der 1880 dem Hamburger Senat die Konstruktionspläne zum Weihnachtsfest übergibt. Zwei Jahre später erfolgt das Richtfest, am 6. Mai 1886 die Grundsteinlegung. Die Bausumme beträgt 4.600.000 Mark. Bis zur Einweihung (26. Oktober 1897) und Fertigstellung (1898) tagt die Rathausbaukommission über 100-mal. Doch es wäre verkürzt, Hallers Wirken auf seinen maßgeblichen Anteil am Rathaus-Neubau zu beschränken, wo er, wie er schreibt, seiner „Vorliebe für italienische Formen bei der Ausbildung der Senatsräume ohne alle Scrupel gefolgt“ ist.
Der Student der Berliner Bauakademie, gebildet in Paris, wo er am Wettbewerb für die neue Oper teilnimmt, der Vorsitzende des „Architekten-Vereins“ Hamburg (1876-1884), der Vater von vier Kindern, der Frankreich-, Italien- und Amerikareisende und das Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (1885-1890) prägt die Belle Époque in Hamburg auch mit zahllosen Luxusvillen rund um die Außenalster, eine Gegend, die zu seiner Zeit bereits „Haller-Land“ getauft wurde. Dazu kamen prunkvolle Domizile wie jenes für das betuchte US-Sammler-Ehepaar Henry und Emma Budge (heute: Musikhochschule) oder repräsentative Stadthäuser wie jenes für den reichen Junggesellen Siegfried Wedells, das 120.000 Mark an Baukosten verschlingt. „Ob ehrlich, ob schlau, ob flott, ob genau. Ob protzig, ob fein, sie brachten mir manchen Groschen ein“, schreibt Haller in seinen Lebenserinnerungen. Er lässt sich mit seiner Familie ab 1891 in seinem selbst erbauten Heim in der Alsterterrasse 2 (heute: Höhe Schanzenbäckerei im PWC-Gebäude) nieder.
Martin Hallers architektonisches Vermächtnis umfasst aber auch 31 Bank- und Geschäftshäuser wie jenes für die Dresdner Bank am Jungfernstieg oder den monumentalen HAPAG-Firmensitz am Ballindamm. Dazu kommen der Bau der Hamburger Musikhalle zwischen 1903 und 1908, ermöglicht durch ein Vermächtnis des Reederehepaars Carl und Sophie Laeisz sowie der Wiederaufbau der Hauptkirche St. Michaelis nach dem Brand im Jahre 1906. Herausragend aber bleiben Planung und Bau des ersten Hamburger Kontorhauses Dovenhof, das 1885/86 in nur 18 Monaten für den Investor Heinrich von Ohlendorff zu einem Preis von 1.500.000 Mark mit 9.000 Quadratmeter Nutzfläche errichtet wurde. Hier muss Haller Schlosser und Ingenieure hinzuziehen, da statt einer Holzbauweise Eisenkonstruktionen zum Einsatz kommen, ebenso technische Neuerungen wie Zentralheizung, elektrische Beleuchtung, Paternoster- und Rohrpostanlagen sowie die Eisenunterstützung massiver Decken. Im Jahre 1967 wird der Dovenhof abgerissen. „Abbruch ist das Los aller unserer Werke“, hatte Haller einmal geschrieben.
Haller baute auch die Villa Fredersdorf in Othmarschen (heute: UN-Seegerichtshof) und jene für den Juristen Dr. Heinrich Wilhelm Bielenberg am Harvestehuder Weg 44 (heute: Anglo-German Club). Für den Baumaterialienhändler Johann Friedrich Krogmann entstand 1868 eine Residenz auf der Uhlenhorst (heute: Gästehaus des Hamburger Senats). Bedenkt man, das das Stadtpalais von Siegried Wedells am heutigen Siegfried-Wedells-Platz als Vorgänger des heutigen Gebäudes am Feenteich bis 1965 Hamburgs nationale und internationale Staatsgäste beherbergte, so hat Martin Haller der Feien und Hansestadt Hamburg zwei Senatsgästehäuser hinterlassen.
Hallers Epoche, geprägt durch Historismus und die Renaissance war gekennzeichnet durch das Repräsentationsbedürfnis des Bürgertums. Auf ihn folgt die rote Backstein-Ära Fritz Schumachers. Karin von Behr gibt in Hallers Biographie erstmals nach der großen Ausstellung über den Hamburger Baumeister des 19. Jahrhunderts im Jahre 1997 einen spannenden und kenntnisreichen Einblick auch in eine wirtschaftliche Boomzeit der Hansestadt. Dr. David Klemm (Hamburger Kunsthalle) bringt es auf den Punkt: „Die Stadt hatte sich zu Beginn seiner (Hallers) Laufbahn gerade von der Katastrophe des Großen Brandes von 1842 und auch von der Finanzkrise von 1857 erholt. Bis zum Ersten Weltkrieg folgte eine insgesamt stabile ökonomische Hochphase, in der die alteingesessenen Hamburger Familien und viele Emporkömmlinge enorme Geldsummen verdienten und in repräsentative Bauvorhaben investieren konnten und wollten.“
Karin von Behr
MARTIN HALLER 1835 – 1925
Privat- und Luxusarchitekt aus Hamburg
Dölling und Galitz Verlag
192 Seiten, 95 Abbildungen, Leinenband
ISBN 978-3-86218-118-6, 24,90 EUR