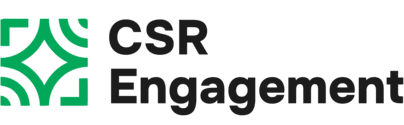Betrifft diese Entschleunigung allerdings richtungsweisende Entscheidungen und Gesetze beim Klimaschutz, verstärkt es das ungute Gefühl mit dem man coronabedingt sowieso schon in die Zukunft schaut. Die erste Lehre aus der Corona-Pandemie müsste doch sein, dass wir mit unserer Erde nicht so umgehen dürfen und können wie bisher. Sie schlägt zurück: mit Naturkatastrophen und leider auch Pandemien.
Umso trauriger ist die Nachricht, wenn bekannt wird, dass der erbitterte Streit um den Insektenschutz und das umstrittene Herbizid Glyphosat weiter geht. Hinter dem Streit steht vor allem das geplante Glyphosat-Aus. Bereits im Sommer 2019 hatte das Kabinett ein Verbot des Pflanzenschutzmittels bis Ende 2023 beschlossen, zusammen mit einer Reihe weiterer Vorgaben zum Schutz von Insekten. Dieses bereits beschlossene Verbot steht jetzt aber wieder zur Diskussion. Aus einem Brief der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner an Kanzleramtschef Helge Braun ging hervor, dass sie sich bei den Entwicklungen für den Insektenschutz durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) übergangen fühlt und zudem befürchtet, dass in der aktuellen Coronalage und somit auch der „aktuell kritischen Lage“ in der Landwirtschaft „sehr genau abgewogen werden muss, welche weiteren Belastungen (…) den Betroffenen in dieser Phase noch zugemutet werden können“. „Eine angemessene Berücksichtigung der berechtigten Belange der Landwirtschaft ist bei dieser Vorgehensweise nicht gewährleistet“, beklagt Klöckner in ihrem Brief weiter. Diese Form der Blockade von oberster Stelle lässt leider befürchten, ob aus dem Insektenschutz-Programm überhaupt noch etwas wird.
| ? Glyphosat
Spätestens seit Glyphosat-Rückstände in Lebensmitteln wie Bier, Getreide, Milch und sogar im Urin und in der Muttermilch nachgewiesen wurden, ist die Verunsicherung in der Bevölkerung groß. Noch mehr Unmut verbreitete die Erkenntnis der Wissenschaftler der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC), dass den Wirkstoff infolge einer eigenen Studie als „wahrscheinlich krebserregend“ einstufte. Diese Folgen für den Menschen wurden nicht weiter belegt, sorgen aber für Unsicherheit. Was belegt ist, dass der Unkrautvernichter Glyphosat negative Auswirkung auf die Umwelt hat. Als Totalherbizid tötet Glyphosat flächendeckend alle Wildpflanzen ab, die auf dem Acker wachsen und gefährdet damit die biologische Vielfalt. Und zwar nicht nur die pflanzliche, sondern auch die der Tiere, die an diese Ackerlebensräume gebunden sind – das sind insbesondere Insekten und Vögel. Zudem steht der Wirkstoff im Verdacht, Bodenorganismen und die Bodenfruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Wenn man bedenkt, dass Glyphosat das mit Abstand am meisten verwendete Pflanzenschutzmittel ist und allein der Verbrauch in Deutschland jährlich bei etwa 3.450 (Wert 2018) Tonnen liegt, dann darf die Frage gestellt werden: Was tun wir unserer Umwelt eigentlich an? |
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hingegen ist für die Erarbeitung der Regeln des Glyphosat-Verbots zuständig, verweist aber weiterhin darauf, dass es in Arbeit ist „allerdings dann doch noch eine Folgenabschätzung brauche“.
Die Entwicklung von Gesetzen und Regeln ist und bleibt eine Sache der Verantwortlichen der Politik. Wenn aber seit dem Beschluss im Sommer 2019 noch nicht einmal Einschränkungen im Einsatz von Glyphosat und ähnlicher Herbizide beschlossen wurden, sind die Befürchtungen von Johann Rathke, Agrarexperte bei der Umweltstiftung WWF nicht unbegründet: „Es geht dem Landwirtschaftsministerium ganz offensichtlich darum, Zeit zu gewinnen. Im Bundestagswahlkampf habe das Glyphosat-Verbot keine Chance mehr.“ Der Weg sollte beim Klimaschutz das Ziel sein. Wenn jetzt nichts passiert, dann ist uns und unserer Erde auch mit Gesetzen in zehn Jahren nicht geholfen.