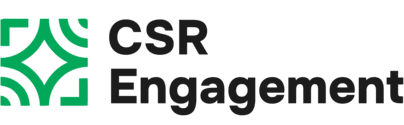Von den insgesamt 128.918 erfassten Arten finden sich mehr als 35.500 in Bedrohungskategorien (die Rote Liste bedrohter Tierarten). Grund dafür sind Lebensraumzerstörung, Wilderei und dazu noch der Klimawandel – das setzt den Arten laut WWF Deutschland immer stärker zu und spricht vom „größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit“. Viele Tiere und Pflanzen lebten in immer kleiner werdenden Gebieten und sind dadurch stark gefährdet.
„Es geht nicht mehr nur um die Beseitigung eines Umweltproblems, sondern um die Frage, ob der Mensch nicht irgendwann auf der Roten Liste in einer Gefährdungskategorie landet“, warnt Dr. Arnulf Köhncke, Leiter Artenschutz beim WWF Deutschland. „Eine intakte Natur ist von existenzieller Bedeutung für uns und unsere Kinder. Ist die Erde krank, werden es auch die Menschen. Das hat uns nicht zuletzt die Corona-Pandemie schmerzlich vor Augen geführt.“ Diese Meinung vertritt nicht nur Köhncke. Es gilt in der Wissenschaft als Konsens, dass Umweltzerstörung Krankheits-Übersprünge von Wildtieren auf den Menschen wahrscheinlicher machen. Durch die Faktoren Lebensraumzerstörung, Wilderei und Klimawandel, werden natürliche Barrieren in bestehenden Ökosystemen aufgebrochen und es bringt die verschiedenen Arten in Kontakt zueinander, die vorher nicht im Kontakt waren. Zusätzlich überschneiden sich die Lebensräume von Mensch und Tier. Eine brasilianische Studie aus dem Jahr 2010 bekräftigt diese Annahme: Die Abholzung von vier Prozent eines Waldes ging mit einer fast 50-prozentigen Zunahme der Malariafälle einher.
Um dem Artensterben entgegenzuwirken, versuchen Forscher seit Jahren Arten zu klonen. Dolly das Schaf wurde 1996 als das erstes erfolgreich geklonte Tier weltberühmt. In den USA gelang es Forschern jetzt, ein Exemplar des Schwarzfußiltis zu klonen, indem sie konservierte Zellen eines längst verstorbenen Wildtiers verwendeten. Die Forscher hoffen, das Schwarzfußiltis Weibchen „Elizabeth Ann“ zu verpaaren und ihre Nachkommen auszuwildern, um wieder mehr dringend benötigte genetische Vielfalt in die Population einbringen zu können.
Ganz abgesehen von ethischen Kritikpunkten ist nicht klar, ob diese Klone langfristig über mehrere Generationen überlebensfähig sind und welche Folgen die Fortpflanzung mit wildlebenden Artgenossen hat. Die Positivbeispiele bei einigen Spezies, wie zum Beispiel den Antilopen oder verschiedene Vogelarten konnten Nachzuchten aus Zoos zum Schutz der Art beitragen. „Eine Auswilderung von hochbedrohten Arten, wie zum Beispiel dem Jaguar, ist jedoch zum Scheitern verurteilt“, erklärt der Wildtierspezialist Thomas Pietsch von Vier Pfoten. „Das Tier könne sich in der freien Wildbahn nicht ernähren, da es zum Beispiel das Jagen nicht gelernt hat und somit im neuen Lebensraum nicht überleben kann.“
Auf diese Probe werden auch die Nachkommen von „Elizabeth Ann“ gestellt, wenn sie voraussichtlich 2024/25 ausgewildert werden. Die in Gefangenschaft gezüchteten Tiere müssen in der Lage sein, Präriehunde zu jagen, und die anderen notwendigen Fähigkeiten besitzen, um allein überleben zu können.