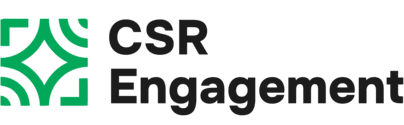Konkret heißt das: Hamburg möchte bis zum Jahr 2055 die eigenen Emissionen um 95 Prozent (im Vergleich zum Jahr 1990) senken. Grundsätzlich ständen Kommunen bei der Beschaffung laut Landeshaushaltsordnung unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Das Ziel muss parallel sein, dass jeder Euro, der investiert wird, möglichst viel CO² einspare. Doch neben dem Einsparen oder Verhindern von Emissionen gibt es auch die nachhaltigen Themenfelder Chancengleichheit, Diversität und Bildung, die es zu beachten gilt.
Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator in Hamburg, betonte nicht nur die Hebel, die man als Stadtstaat umlegen kann – „nachhaltige Stadtwirtschaft“ – sondern insbesondere den wichtigen Beitrag, den die Haushalts- und Finanzpolitik leisten kann, wenn es darum geht, der menschengemachten Klimaveränderung entgegen zu setzen. Green Bonds, Nachhaltigkeitsvorgaben oder die eigene Haushaltsaufstellung sind nur einige Maßnahmen, um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Sein Bremer Äquivalent, der Finanzsenator Dietmar Strehl, freut sich, dass vor über 10 Jahren in Bremen damit begonnen wurde, die Beschaffung schrittweise nachhaltiger zu gestalten. Seitdem sind Stellen für nachhaltige, aber auch sozial verantwortliche Beschaffung geschaffen worden; zudem wurde vor sechs Jahren ein elektronischer Einkaufskatalog bereitgestellt worden. Nachhaltige Rahmenverträge werden ausgeschrieben und Nachhaltigkeitskriterien im Umfang von bis zu 30 Prozent werden vor der Auftragserteilung berücksichtigt.
Klar ist: Es sind Anstrengungen, die unternommen werden müssen, um als Stadt, Land oder Kommune klimaneutral zu werden oder die ESGs der Vereinten Nationen zu erfüllen. Auf der einen Seiten stehen soziale und ökologische Ziele bzw. Aufgaben, auf der anderen Seite ökonomische. Doch Aufgaben werden angenommen und angegangen. Und wenn zwei Hansestädte wie Bremen und Hamburg, die ja oft als Rivalen gelten, den Dialog dazu hinbekommen, sich austauschen und auf ein Ziel hinarbeiten, macht das Mut für weitere Projekte.