„Wenn Schiffe auf hoher See sind und es zu Problemen kommt, können sie dich über Bord ins Meer werfen.“ „Es ist für Euch gefährlich diese Dokumentation zu drehen. Es gibt da viele Risiken.“ „Wenn ihr Angst habt zu sterben, solltet ihr heimfliegen.“ Mit diesen Zitaten gibt der Anfang von Seaspiracy einen Einblick, was die Macher im Laufe der Dokumentation erwartet. Es sind ungeahnte Situationen und Machenschaften, die während einer Reise aufgedeckt werden, die eigentlich nur der Erstellung eines Dokumentarfilms über die Wunder des Meereslebens dienen sollte. Aus dem Wunsch, in die faszinierenden Tiefen der Ozeane einzutauchen, wurde eine Dokumentation über eine Realität, die unser aller Lebensgrundlage zerstört: Die ökologischen Auswirkungen des globalen Fischfangs.
Weltpremiere feierte der Film von Ali und Lucy Tabrizi am 24. März dieses Jahres auf der Streamingplattform Netflix. Auf spannende Art und Weise nimmt der Protagonist Ali den Zuschauer mit auf eine investigative Reise in die Welt der Ozeane, in der rund 80 Prozent allen Lebens zuhause ist und die zum Großteil noch nicht erforscht wurde. Dabei erfährt er immer wieder frustrierende Situationen und entdeckt den globalen Zusammenhang zwischen Regierungen, Industrie, mafiösen Strukturen und Umweltschutzorganisationen. Ein kleiner Einblick.
Wale, Delfine, Haie – ein Milliardengeschäft
Die Reise beginnt in Asien, genauer gesagt in Japan. Obwohl international verboten, hat sich das Land vor einigen Jahren wieder zum Walfang bekannt und bekämpft regelrecht kleine Wale und Delfine. Auf dem Weg zum Ort des Geschehens werden Ali und seine Begleiterin Lucy von Polizei und Geheimdiensten observiert und stoßen auf eine ablehnende Haltung der Menschen. Das Geheimnis, das auf diese Weise bewahrt werden soll: Pro Jahr werden rund 700 Delphine und kleine Wale in eine kleine Bucht im Süden Japans getrieben. Dort werden Jungtiere für die Meeresparkindustrie gefangen, der Rest wird regelrecht abgeschlachtet. Der Grund: Schädlingsbekämpfung. Delphine werden dafür verantwortlich gemacht, zu viele Fische zu fressen. Dabei ist der Grund für weniger Fisch eine gnadenlose Überfischung der Meere.
Durch Zufall gerät Ali in einen Nachbarhafen, der sich als Umschlagplatz für eine Milliardenindustrie herausstellt: Thunfisch aller Art – auch bedrohte Spezies wie dem Roten Thun. Ein Fisch dieser Art allein erzielt auf dem Fischmarkt in Tokio über 3 Millionen Dollar. Einige Thunfisch-Bestände sind bereits überfischt. Dennoch erwirtschaftet die Thunfisch-Industrie pro Jahr weltweit 42 Milliarden Dollar.
Neben den Thunfischen entdecken Ali und der Zuschauer Haie, denen die Flossen abgeschnitten werden. Man ahnt: Ein weiteres Milliardengeschäft.
Die Reise führt nun nach Hong Kong, das als „Sharkfin City“ gilt. Dort zu filmen erweist sich als schwieriger als gedacht und so werden von Ali und Lucy versteckte Minikameras eingesetzt. Die Konzerne, die hinter dem so genannten „Shark finning“ stecken, sind oftmals extrem kriminell und mafiös organisiert. Haifischflossensuppe gilt in China als Statussymbol, das pro Schüssel über 100 Dollar kostet, dabei aber weder nach etwas schmeckt, noch besondere Nährstoffe enthält. Unter anderem durch diese Delikatesse sind Haie erstmals in der Geschichte vom Aussterben bedroht.
Mit der Darstellung dieser Tatsachen fängt der Film an, den grausamen Eingriff des Menschen in den Lebensraum der Ozeane zu dokumentieren, dessen Folgen aufzuzeigen und mit Fakten zu unterlegen.
Täter: kommerzieller Fischfang
Das größte Problem für die Ozeane, das dem Zuschauer im Laufe des Films aufgezeigt wird, ist der kommerzielle Fischfang. Durch den Einsatz von Schleppnetzen, die so groß sind wie Kathedralen, werden jedes Jahr rund 1,5 Milliarden Hektar Meeresböden zerstört und somit ein empfindliches und wichtiges Pflanzensystem. Denn Meerespflanzen können bis zu 20mal mehr Kohlenstoff aufnehmen als Wälder.
Ein weiteres Problem ist der Beifang, der zwar als Versehen tituliert, aber aus wirtschaftlichen Gründen einkalkuliert wird. Mit erschreckenden Zahlen wird uns bewusst gemacht, welche Folgen unser Fischkonsum hat. So verenden zum Beispiel pro Jahr 10.000 Delfine als Beifang vor der französischen Atlantikküste, im Laufe eine Monats zählt ein kleiner isländischer Fischerbetrieb rund 269 Schweinswale, 900 Robben und 5.000 Seevögel in seinen Netzen.
Und wer bisher glaubte, dass Plastikstrohhalme und Wattestäbchen hauptsächlich verantwortlich für die Verschmutzung der Meere sind, wird eines Besseren belehrt: Rund 46 Prozent des Plastiks im so genannten Great Pacific Garbage Patch, dem Müllteppich im Pazifik, machen alte Fischernetze und Fischerei-Ausrüstung aus.
Die (Ohn)Macht der Nachhaltigkeitssiegel
Wer sich zudem bisher sicher fühlte, nachhaltig gefangenen Fisch zu konsumieren, indem er auf entsprechende Siegel achtet, sollte bei diesem Film stark sein, denn im Gespräch mit Experten und Vertretern von Umweltorganisationen wird klar: Ein nahhaltiges Fischen, das zum Beispiel Wale und Delfine schützt, gibt es nicht. Die Siegel basieren oftmals auf den Angaben der Fischer und eine Kontrolle findet immer seltener statt, denn entsprechende Beobachter leben gefährlich. Manche bezahlten ihre Tätigkeit mit dem Leben. Mit Angaben auf Treu und Glauben und gegen einen finanziellen Beitrag sind offenbar Siegel wie das MSC erhältlich. Der Film macht deutlich: Sie vertuschen oftmals, was draußen auf See passiert.
Über Sklaverei und Piraterie bis hin zur Subventionierung
Was Seaspiracy als Dokumentarfilm so sehenswert macht, ist das Aufzeigen der Zusammenhänge und Konsequenzen. Dabei rücken die Macher auch unbequeme Wahrheiten ins Licht wie eine brutale Versklavung von jungen Männern in der Fischindustrie, die Entstehung von Piraterie durch den Diebstahl von Fischbeständen und die weltweite Subventionierung des ganzen Systems durch den Steuerzahler. Ein komplexer Film, der die Augen öffnet, zum Nachdenken anregt – und zum Handeln auffordert.
Die Petition: 30 Prozent der Meere unter Schutz
Dass alle Welt nun keinen Fisch mehr isst, ist auch nach diesem Film sicherlich utopisch. Dass aber 30 Prozent der Meere unter Schutz gestellt und somit eine komplette Fangverbotszone eingerichtet wird, weniger. Diese Zonen sind nach Expertenmeinungen wichtig, um die Ozeane vor dem Aussterben zu bewahren. Dafür setzen sich die Macher von Seaspiracy, Ali und Lucy Tabrizi, ein.
Sie sammeln Unterschriften mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 den Schutz für einen Teil der Meere zu erreichen. In Deutschland richten sie ihren Appell an Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Knapp 600.000 haben die Petition bereits unterschrieben. Ziel sind 1.000.000 Unterschriften. Wer sich anschließen möchte, hat hier dazu online die Möglichkeit.
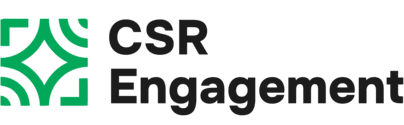
One thought on “Ein Filmtipp zum Weltfischbrötchentag”