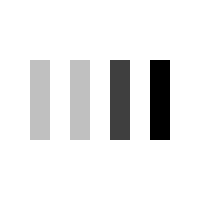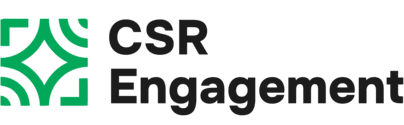Pia Kemper, Spiritus Rector diverser RP-Foren, brachte eingangs auf den Punkt, was die Beschäftigung mit der Zukunftsmedizin von allen anderen Diskussionsformaten des Verlagshauses unterscheidet. Es ist die Reise in die Zukunft der datengetriebenen Medizin, bei der eher der Weg das Ziel ist, weil sich aus den Labs ob der exponentiellen Beschleu-nigung des Wissens immer wieder neue Aspekte und daraus Richtungsänderungen für die Expertenbeschäftigung ergeben. Der Fokus jedoch bleibt unverändert: ein Portal zu entwickeln, das neueste Forschungsergebnisse und den Stand der Diskussionen aus Labs und Foren verbraucherkompatibel aufbereitet, Orientierung stiftet und auch die Rückkoppelung mit den Lesern organisiert. Seien es Umfragen, deren Ergebnisse wissenschaftlich ausgewertet und an die Leser/User zurückgespielt werden oder sei es gar die Beteiligung von Vertretern der interessierten Öffentlichkeit an den Foren.
Einigkeit bei allen hoch kontroversen Diskussionen bestand darin, dass die Digitalisierung in dienender und nicht in dominierender Funktion zu betrachten ist. Der Frankfurter Onkologe Prof. Dr. Hubert Serve sieht gar ein Manko der modernen Medizin: „Sie hört zu wenig zu. Wir wissen oft nicht, wie es dem Patienten geht. Das persönliche Arzt-Patienten-Gespräch muss verbessert werden. Der Erkrankte fühlt sich im hoch-komplexen System allein gelassen.“ Dem pflichtete HanseMerkur Leistungs- und Gesundheitsmanager Folke Tedsen bei: „In der Digitalität liegen Riesenchancen. Man kann das Angebot auf viele verbreitern und über ein Trichtersystem die ärztlichen Ressourcen viel effektiver und zielgerichteter nutzen.“ Tatsächlich liegen die Deutschen mit durchschnittlich 14,6 Arztbesuchen jährlich – viele davon wegen Bagatellerkrankungen – an der Weltspitze und ein Umsteuern ist dringend erforderlich.
Prof. Dr. Felix Hilpert, Gesellschafter am Mammazentrum Hamburg, sprach sich ebenfalls gegen eine virtuelle Medizin aus, sieht in der täglichen Praxis viele fragile Erkrankte und möchte die Arzt-Patientenkommunikation schärfen. „Menschen sind in Not und neigen dazu, das zu suchen, was sie brauchen und daraus entstehen Risiken.“ Auch er sieht elektronische Helfer wie Distress Apps positiv, da sie niedrigschwellige Symptome filtern könnten, bevor ein Arztbesuch erforderlich wird. Die umfassende Sammlung oder gar Teilung von Genomdaten sieht Hilpert aber sehr kritisch: „Das Recht auf Nichtwissen ist hoch.“ Der Hannoveraner Forschungs- und Public Health Ethiker Dr. Marcel Mertz mag sich digitale Lösungen, die direkt an den Patienten gerichtet sind, als diagnostische Unterstützung vorstellen, sieht aber auch Gefahren im Overkill von frei zirkulierenden Patienten-informationen, da sie das Selbstbestimmungsrecht verletzten könnten.
Den Copytest zu all diesen Einlassungen gab es über drei Arbeitsgruppen, die in einer Stunde Prototypen eines nutzerorientierten online-gestützten Services im Lean Start-up Verfahren entwickelten: Drei Gesundheits-Apps für a) Menschen, die bereits erkrankt sind (55+); b) ein bestimmtes Krankheitsbild und c) für junge Menschen (18-30) unter der Fragestellung „Ich will gesund bleiben, wer kann mir dabei helfen?“ Für Moderator Christopher P. Peterka der „Gang raus aus der Komfortzone. Was wir früher in zehn Jahren entwickelt haben, findet heute in einem Jahr statt. Der Ponton bewegt sich und das ist gut.“
Bewegung in die Diskussion brachte vor allem die App-Entwicklung einer Arbeitsgruppe um den Onkologen Prof. Serve und den US-Tumorforscher Tim Greten, M.D. Gedacht in dienender Funktion für jene über sieben Millionen Menschen, die in Deutschland an Diabetes erkrankt sind und deren Zahl nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im Jahre 2040 auf mehr als 12 Millionen ansteigen wird. Eine Nationale Diabetes-Strategie ist in Arbeit und fordert u.a. auch ein einheitliches Monitoring. Unter der Prämisse, dass es über eine App der Patientengruppe auch mit Risiko für Diabetes Typ 2 ermöglicht werden soll, eine rechtzeitige Diagnose zu erhalten, ihre Lebensqualität zu verbessern, Lifestyle-Modifikationen zu erzielen und das Krankheitsmonitoring verantwortlich in die eigenen Hände zu nehmen, schlug die AG u.a. vor, sämtliche Gesundheitsdaten per gesetzlicher Grundlage zugänglich zu machen, Algorithmen zu hinterlegen, die Hinweise zum Aufsuchen eines Arztes bei eskalierenden Werten geben und Schrittzähler, Glukose-Monitor, Essgewohnheiten und Alter/Gewicht regelmäßig mit Hausarzt, Patient Clubs etc. zu teilen. Der Aufschrei in der Expertenrunde war groß und zeigt, wieviel Überzeugungsarbeit auch in der medizinischen Fachwelt noch erforderlich sein wird, Digitalität in dienender Funktion zu nutzen und zu akzeptieren. Für Prof. Serve stand am Ende der Lab-Debatte jedenfalls fest: „Ich finde es zynisch, mit welcher Leichtigkeit über Menschen hinweggegangen wird, die Hochrisikopatienten sind und es oft nicht wissen.“
Dass möglicherweise Patienten der Nutzung von Gesundheits-Apps wesentlich aufgeschlossener gegenüberstehen als es der Fachdiskurs vermuten lässt, hat gerade das Meinungsforschungsinstitut Kantar (Continentale-Studie 9/2019) repräsentativ erhoben. Demnach sehen 62 Prozent der Befragten den Einsatz von Gesundheits-Apps positiv, da die App ihnen Aufgaben abnimmt, so dass sie sich nicht ständig mit dem Thema auseinander-setzen müssen. Und für 52 Prozent bedeutet ein ständiges Monitoring ein Gefühl der Sicherheit, da durch die elektronische Warnung bei kritischen Werten frühzeige Maßnahmen zur Vermeidung medizinischer Folgen eingeleitet werden können.
Auch das Lab 2/2019 des Forums Zukunftsmedizin der Rheinischen Post stand für spannende Diskussionen und hochkarätige Teilnehmer. Neugierig dürfen wir schon jetzt sein auf die RP-Beilage an die Leser, die natürlich auch online gespielt wird. Denn bei aller Datenobsession bricht die Medienhabilitandin Dr. Alexa Burmester von der Uni Hamburg eine Lanze für Print: „Medien, die einen Anfang und ein Ende haben, haben auch in der digitalen Zukunft einen Mehrwert.“ Die Reise geht also weiter, auch zu den Themen Patient Empowerment, Ethik und Datenschutz. Haben doch gerade erst der Bayerische Rundfunk und die US-Investigativplattform ProPublica recherchiert, dass 13.000 hochsensible medizinische Datensätze auch von deutschen Patienten auf ungesicherten Servern liegen. Fortsetzung folgt. Mehr unter www.forum-zukunftsmedizin.de.
Hier noch einige Stimmen der Teilnehmer des aktuellen Labs zum Forum Zukunftsmedizin:
Prof. Dr. Felix Hilpert, Mammazentrum Hamburg am Krankenhaus Jerusalem
Einmal in der direkten Arzt-Patienten-Beziehung haben wir uns vom paternalistischen System der Sechziger und Siebziger Jahre zum partizipativen Entscheidungssystem mit unseren Patienten entwickelt. Das heißt, wir versuchen sie zu informieren über ihre Erkrankung und stellen ihnen dar, was das Problem ist, wie die Lösungen aussehen und müssen versuchen, sie in die Lage zu versetzen, mit uns zusammen zu entscheiden ,den richtigen Weg für ihre Situation zu wählen. Da spielt Patient Empowerment eine zentrale Rolle. Wenn ich Patienten habe, die informiert sind, die durch Selbsthilfegruppen über Informationen verfügen, was mit ihnen gerade passiert, wo sie sind, mit wem sie reden, dann macht das Vieles leichter.
Dr. Marcel Mertz, Medizinische Hochschule Hannover
Es ist in erster Linie eine Frage nach dem allgemeinen Patientenwohl und der Frage nach der individuellen Selbstbestimmung. Es wäre natürlich sinnvoll, Patienten aus einer Risikogruppe werden rechtzeitig darauf hingewiesen, damit sie ein besseres und längeres Leben genießen können. Aber die Frage bleibt: erzwingen wir das Nutzen solcher Apps oder belassen wir es bei der Freiwilligkeit? Wenn ich etwas freiwillig nutze ist das ein anderer Ansatz als wenn ich dazu verpflichtet würde. Der gesellschaftliche Diskurs der nächsten Jahre mag aber dahin gehen, dass das Kollektiv wichtiger ist als die Selbstbestimmung des Einzelnen. Im Moment ist es allerdings so, dass der Respekt vor der Patientenautonomie ein absoluter Grundwert ist, den wir in der Medizin zu achten und zu schützen haben.
Prof. Dr. Hubert Serve, Universitätsklinikum Frankfurt
Es gibt einen relativ hohen Prozentsatz von nicht erkanntem Diabetes Mellitus Typ 2. Und wenn der frühzeitiger erkannt würde, ist es durchaus so, dass die Komplikationsrate massiv gesenkt werden könnte, dass die Patienten mit dieser Erkrankung besser eingestellt werden. Eine frühzeitige Diagnose ist ein entscheidendes Kriterium für die Qualität der Versorgung dieser Menschen. Und unser Vorschlag war eben, dass man einen Algorithmus generiert, der aus den Gesundheitsdaten des Handys eine Warnmitteilung für die Menschen generiert, wenn sie ein hohes Risiko haben aufgrund ihres Bewegungsprofils oder ihres Konsumverhaltens an Diabetes Typ 2 erkrankt zu sein, dass sie sich mal testen lassen sollen beim Arzt. Schon das ist auf erheblichen Widerstand gestoßen. Das fand ich sehr interessant.
Folke H.Tedsen, Leistungs- und Gesundheitsmanagement, HanseMerkur
Wir wissen schon seit vielen Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten, dass 70 Prozent der Hausarztbesuche im Prinzip überflüssig wären, weil Bagatellerkrankungen behandelt werden. Wenn wir schon mal da ansetzen, dass wir die Spreu vom Weizen trennen, dass wir die ärztlichen Ressourcen so nutzen, da, wo es wirklich notwendig ist und sie von vielen Bagatellbehandlungen befreien und die Zugangswege der Patienten so gestalten, dass sie sich jederzeit Rat holen können und mit diesen Ressourcen schonender umgehen, dann wäre unheimlich viel gewonnen.
Fotos: Rheinische Post und Heinz-Gerhard Wilkens