Das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos galt als Schandfleck europäischer Flüchtlingspolitik. Als es vor einem halben Jahr nahezu vollständig abbrannte, keimte die Hoffnung auf, dass nun endlich etwas passiert. Dass die nun obdachlos gewordenen Flüchtlinge auf alle EU-Staaten verteilt werden. Dass sie bessere Unterkünfte erhalten. Dass sie genügend Platz und Zugang zu sanitären Anlagen bekommen, um sich – wie der Rest der Welt – durch die Einhaltung der Hygieneregeln vor dem Corona-Virus schützen zu können. Dass die vielen Kinder dort endlich eine Chance auf ein normales und gewaltfreies Leben bekommen. All das hatte man gehofft, als die dramatischen Bilder von dem brennenden Lager um die Welt gingen und uns panische und verzweifelte Menschen zeigten. Männer, Frauen und Kinder, die mit nichts als der Kleidung an ihrem Körper vor dem Feuer flohen.
Doch die Bilanz nach sechs Monaten zeigt, dass aus dem Schandfleck Moria das Armutszeugnis Kara Tepe geworden ist. Das neue Lager auf dem ehemaligen Militärgelände Kara Tepe ist nichts weiter als ein Zeltdorf. Es sind Sommerzelte, die weder vor Kälte noch Nässe ausreichenden Schutz bieten. In jedem Zelt sind durchschnittlich zehn Personen untergebracht, durch Plastikplanen notdürftig getrennt. Privatsphäre gibt es nicht. Sie schlafen auf Schutt und Steinen, denn die Zelte haben keinen Boden. Wenn es regnet, steht das halbe Lager unter Wasser. Was als Übergangslösung angekündigt wurde, wurde zur Dauerlösung. Es herrschen katastrophale Zustände: Seit Monaten mangelt es noch immer an fließendem Wasser, Strom und warmem Essen. Vor kurzem stellte eine Hilfsorganisation die ersten Duschen mit warmem Wasser auf. Seitdem darf sich jeder der über 7.000 Bewohner einmal in der Woche kurz dort waschen. Im Lager ist inzwischen die Krätze ausgebrochen. Unter den aktuellen Bedingungen nicht verwunderlich und auch nicht zu beseitigen. Ärzte ohne Grenzen fordert daher seit Monaten die Evakuierung des Lagers.
Seit 2015 erhielt Griechenland insgesamt drei Milliarden Euro für das Management der Flüchtlingspolitik, fünf Millionen davon im November 2020. Kein anderes Land hat so viel Geld von der EU bekommen. Wie kann es da sein, dass in Kara Tepe und zuvor in Moria derartige Zustände herrschen? Gerald Knaus, österreichischer Soziologe und Migrationsforscher, vermutet gegenüber dem Magazin Panorama, dass das so gewollt ist: „Es ist eine strategische Entscheidung, genau durch diese Bilder von Menschen, die leiden, andere davon abzuhalten, zu kommen. Das ist derzeit die Politik der Europäischen Union.“
Knaus sieht aber nicht die griechische Regierung allein, sondern alle EU-Staaten in der Verantwortung. Die Bundesregierung hatte sich nach dem Brand zur Aufnahme von 1.553 Geflüchteten von den griechischen Inseln entschieden. Laut Bundesinnenministerium sind davon bisher nur 291 Menschen aufgenommen. Das hinge mit der Corona-Pandemie zusammen und läge in der Zuständigkeit der griechischen Behörden, deren Aufgabe die Auswahl und Umverteilung der Menschen sei, heißt es. Die wiederum haben jedoch kein großes Interesse an einer schnellen Verteilung der Menschen. Die Meldung, dass sich die Lage auf Lesbos entspannt, würde nur für neue Flüchtlingsströme sorgen.
Wieder einmal sind es nur die NGOs, die akut helfen, um das Leid und die Not der Menschen zu lindern. Sie versorgen die Geflüchteten mit Kleidung und Nahrung so gut es eben geht. Sie bauen Böden in den Zelten, damit die Bewohner nicht im Schlamm versinken. Sie leisten eine medizinische Grundversorgung und kümmern sich um die Kinder. Die Kleinsten der Gesellschaft trifft dieses Elend am härtesten. Viele von ihnen kennen nichts anderes als das Leben auf der Flucht und im Lager. Sie sind von dem Elend und den unzähligen Gewalterfahrungen schwerst traumatisiert. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit kennen sie nicht. Das soziale Umfeld, in dem sie heranwachsen, ist ein knallharter Überlebenskampf.
Im Dezember zeichnete UNICEF das Foto des griechischen Fotografen Angelos Tzortzinis als UNICEF-Bild des Jahres 2020 aus. Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender sagte, das Foto sei eine „eindringliche Mahnung“. Es erzähle ein Drama direkt vor unserer Haustür. „Das Bild konfrontiert uns mit unserer Menschenpflicht: Wir in Europa müssten endlich eine Antwort finden – auch für die Kinder von Moria. Wir müssen gemeinsam mehr tun, um auch in ihr Leben Hoffnung zu bringen.“
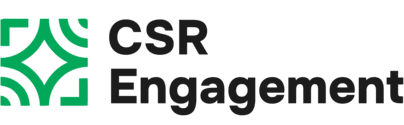
Danke für den Artikel, der übrigens sehr gut geschrieben ist. Es ist wichtig, dass dieses Thema endlich wieder Präsenz bekommt. Wir (die Gesellschaft, die Medien, die Politik) kümmern uns seit einem Jahr wieder mal nur um uns und leiden auf höchstem Niveau, obwohl die meisten von uns gar nicht wissen was das bedeutet. Die Überschrift ist so passend, es ist wirklich beschämend.