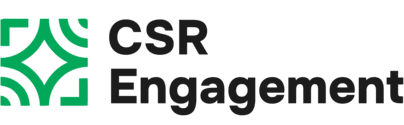Laut dem aktuellen Bericht „Child Labour: Global Estimates 2020, trends and the road forward”, der erstmals gemeinsam von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und UNICEF erstellt wurde, ist die Zahl der Kinder in Kinderarbeit weltweit auf 160 Millionen gestiegen. Das ist eine Zunahme um 8,4 Millionen Kinder in den letzten vier Jahren.
Damit sind die Fortschritte bei der Überwindung von Kinderarbeit zum ersten Mal seit 20 Jahren ins Stocken geraten und der bislang positive Trend hat sich umgekehrt: Zwischen 2000 und 2016 war die Zahl der Mädchen und Jungen in Kinderarbeit noch um 94 Millionen gesunken.
Der Bericht warnt zudem, dass weltweit neun Millionen Kinder zusätzlich bis Ende 2022 durch die COVID-19-Pandemie in Kinderarbeit gedrängt werden können. Ein Simulationsmodell zeigt, dass diese Zahl auf 46 Millionen ansteigen könnte, wenn gefährdete Kinder keinen Zugang zu angemessenen sozialen Basisschutzmaßnahmen haben.
Der Grund dafür: Das Einkommen vieler Familien ist Pandemie-bedingt eingebrochen, viele Schulen wurden zudem geschlossen und Regierungen bieten wenig bis gar keine Unterstützungs- oder Basisschutzmaßnahmen. Die Folge: Viele Kinder gehen arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Schätzungsweise 152 Millionen Menschen weltweit sind im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der Pandemie in extreme Armut geraten.
Fünf- bis elfjährige Kinder am stärksten betroffen
Vor allem die Zahl der jungen Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren in Kinderarbeit ist deutlich angestiegen, so dass diese Altersgruppe nun weltweit etwas mehr als die Hälfte der von Kinderarbeit betroffenen Kinder stellt. Aber auch die Zahl der Kinder im Alter von fünf bis 17 Jahren, die besonders gefährliche Arbeit verrichten – also Tätigkeiten, die ihre Sicherheit, körperliche oder seelische Gesundheit bedrohen –, ist seit 2016 um 6,5 Millionen auf 79 Millionen gestiegen.
Erschreckende Daten, die sich zudem einzelnen Sektoren zuordnen lassen: Dem Bericht zufolge arbeiten 70 Prozent der Mädchen und Jungen im Agrarsektor (112 Millionen), wie zum Beispiel auf Kakaoplantagen, gefolgt von 20 Prozent im Dienstleistungssektor (31,4 Millionen), wie beispielsweise dem Tourismus, und zehn Prozent in der Industrie (16,5 Millionen), was Steinbrüche, Goldminen oder auch Textilfabriken einschließt.
Mit dem Internationalen Jahr gegen Kinderarbeit rufen die Vereinten Nationen nun weltweit Regierungen dazu auf, alles Notwendige auf den Weg zu bringen, um die schlimmsten Formen von Kinderarbeit zu beseitigen und zu verbieten. Bis 2025 soll Kinderarbeit in jeglicher Form beendet sein.
Lieferkettengesetz – zu kurz gegriffen und wenig effektiv?
Passend dazu ist heute die Verabschiedung des Lieferkettengesetzes durch den Deutschen Bundestag geplant. Denn auch wenn wir es nicht gern hören: Auch in den Lieferketten deutscher Unternehmen steckt Kinderarbeit. Aber kann dieses Gesetz die Kinderarbeit vermeiden oder gar abschaffen?
Sämtliche Kinderrechts- und Kinderschutz-Organisationen beurteilen diese Maßnahme deutlich als unzureichend, zu kurz greifend und somit wenig effektiv. Der Grund liegt in der Ausgestaltung des Gesetzes. Ab 2023 müssen Unternehmen ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen: Sie sind dazu verpflichtet, entlang ihrer Lieferkette auf die Einhaltung der Menschenrechte – was das Verbot von Kinderarbeit einschließt – zu achten. Dies bezieht sich allerdings nur auf direkte Vertragspartner, nicht auf deren Zulieferer. Das ist ein Problem, denn oftmals werden Produkte nicht direkt vom Erzeuger oder Produzenten selbst gekauft, sondern von dazwischengeschalteten Großhändlern oder Handelsagenturen, die entweder nicht unbedingt in Deutschland sitzen oder für die Anwendung des Gesetzes zu klein sind. Die tiefergehende Lieferkette müssten Unternehmen nur anlassbezogen auf Menschenrechtsverletzungen überprüfen oder wenn sie substanzielle Kenntnis darüber haben. Dies lädt leider eher zum Wegschauen als zum konsequenten Handeln ein.
Ein weiterer Kritikpunkt: Das Gesetz gilt nur für wenige Unternehmen. Ab 2023 gilt es zunächst für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter – was aktuell rund 600 Stück sind. Ab 2024 soll es dann auch für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter gelten. Das wären rund 2.800 Unternehmen in Deutschland. Kleinere Unternehmen sind nicht von dem Lieferkettengesetz betroffen und Haftungsregeln bei Verstößen sieht das Gesetz ebenfalls nicht vor.
Die Frage bleibt, ob das Lieferkettengesetz maßgeblich etwas an dem Thema Kinderarbeit ändert, wenn die unternehmerische Sorgfaltspflicht dahingehend nicht entlang der gesamten Lieferkette verbindlich gemacht wird. Zudem ist Deutschland ja nicht das einzige Land, dass auf globale Lieferketten setzt. Dennoch ist das Gesetz trotz aller Schwächen ein erster und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Hoffentlich wird es aber nicht der Letzte sein.
Foto: © UNICEF/UNI277633/Berger